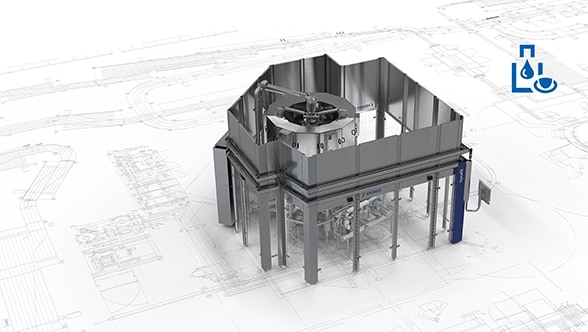Bastian Leikeim ist frisch zurück aus Denver, Colorado, wo er als Juror beim World Beer Cup, dem größten Bierverkostungswettbewerb der Welt, tätig war. Eine tolle Erfahrung, sagt er: „Es ist schön, mal wieder aus der eigenen Blase rauszukommen und sich mit Kollegen aus der ganzen Welt auszutauschen. Es gibt einfach nichts Schöneres, als über Bier zu reden.“ Nun, Anfang Mai, ist er wieder in der heimischen Blase im denkmalgeschützten Brauhaus in Altenburg in Thüringen. Leikeim stammt aus einer fränkischen Brauerfamilie. Anfang der 90er Jahre kaufte und sanierte sein Vater das Altenburger Brauhaus. „Er hat sich immer alte Brauhäuser angeschaut, und dieses hier ist wirklich etwas Besonderes“, sagt Bastian Leikeim, der die Brauerei heute leitet. Das Jugendstil-Gebäude entstand 1913, damals als Zuhause für eines der modernsten Sudhäuser Europas, gebaut von Theodor Ganzenmüller, dem in Brauerkreisen legendären Professor der Bayerischen Akademie für Landwirtschaft und Brauwesen in Weihenstephan.
Heute beschäftigt der Betrieb 50 Personen und braut rund 100.000 Hektoliter Bier im Jahr. Abgefüllt wird in Bügelflaschen, die Rohstoffe bezieht man aus der Region. Das gelingt sogar für Hopfen, weil das Anbaugebiet Elbe-Saale direkt um die Ecke liegt. Stolz ist man auf die vielen Preise, allen voran für das Altenburger Premium Pils. „Wir sind mittlerweile die am meisten international ausgezeichnete Brauerei in Mitteldeutschland“, freut sich der Chef. Ihr Sortiment ergänzt Altenburger immer wieder um saisonale Spezialitäten. Einer der jüngsten Erfolge ist das alkoholreduzierte Sommerhell. „Das ist unseren Braumeistern wirklich gut gelungen“, betont Leikeim: „Das Bier hat mit elf Grad Plato immer noch einen gewissen Körper, aber nur 3,5 Prozent Alkohol.“